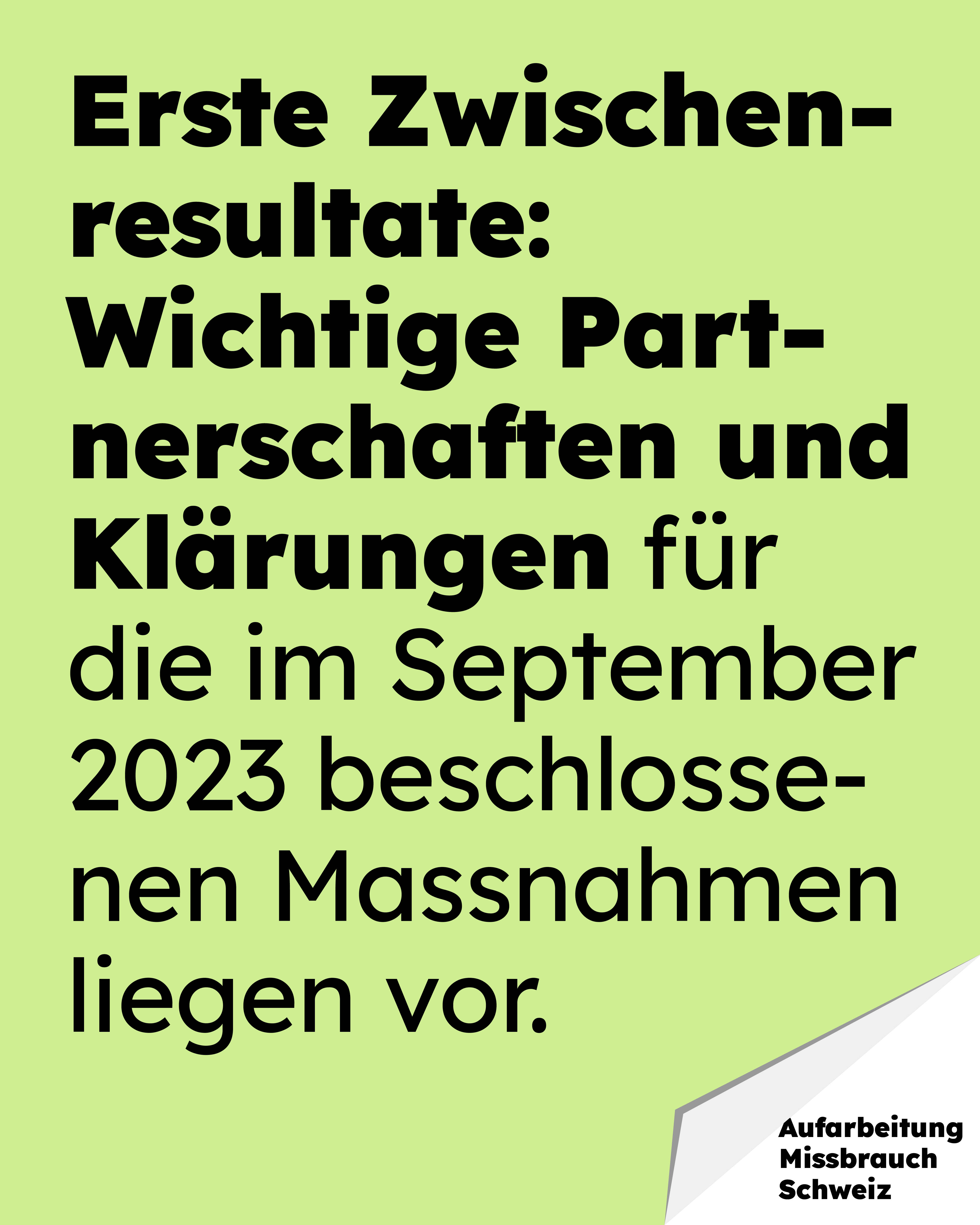Unabhängige Opferberatung seit Anfang Januar 2025 schweizweit in Kraft
Information vom 29. Januar 2025
Im Verlauf von 2025 setzt die römisch-katholische Kirche neue Kooperationen, Standards und Abläufe in Kraft, um sexuellen Missbrauch und dessen Vertuschung zu verhindern und Opfer überall in der Schweiz professionell zu unterstützen: Seit Anfang Jahr bieten die kirchlichen Meldestellen keine eigene Opferberatung mehr an, sondern verweisen konsequent an die kantonal anerkannten Opferberatungsstellen, wo Betroffene unabhängige Unterstützung und Beratung erhalten. Ein Leitfaden zur Führung von Personaldossiers und ein wissenschaftlich abgestütztes Assessment für angehende Seelsorgende schaffen im Personalmanagement Voraussetzungen, um Risiken zu minimieren. Sie werden im Lauf des Jahres eingeführt. Die nationale Dienststelle Missbrauch im kirchlichen Kontext verfügt seit Anfang Januar über mehr Ressourcen, um die Konkretisierung und Umsetzung des ganzen Massnahmenpakets voranzubringen.
Die Schweizer Bischofskonferenz (SBK), die Römisch-Katholische Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ) und die Konferenz der Vereinigungen der Orden und weiterer Gemeinschaften des gottgeweihten Lebens (KOVOS) erarbeiten auf nationaler Ebene eine Reihe von Massnahmen, mit denen die Aufarbeitung des Missbrauchs im kirchlichen Kontext fortgesetzt und institutionelle Mängel angegangen werden.
Schweizweit einheitliche und kirchenunabhängige Opferberatung in Kraft
Seit Anfang Januar 2025 ist die Opferberatung schweizweit von der Kirche unabhängig. Damit ist ein erster Meilenstein erreicht: In der ganzen Schweiz können sich Betroffene an die unabhängigen professionellen Beraterinnen und Berater der von den Kantonen anerkannten Opferberatungsstellen wenden. Die Beratungsstellen und ihre Angebote sind über www.opferhilfe-schweiz.ch erreichbar. Bis anhin hatten auch kirchliche Stellen diese Aufgabe übernommen, mit je nach Bistum unterschiedlichen Vorgehensweisen. Die Zusammenarbeit wurde zwischen der römisch-katholischen Kirche und der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) geregelt. Eine Fallpauschale von 1'500 Franken entschädigt die Stellen für Zusatzaufwand, der aufgrund der Komplexität der kirchlichen Strukturen und der Abklärungen mit verschiedenen kirchlichen Stellen entsteht.
Die Betroffenenorganisationen (IG-M!kU, SAPEC, GAVA) tragen die neuen Regelungen mit und auch die Anlaufstelle für verjährte Fälle in der Westschweiz CECAR nimmt sie zur Kenntnis. Sie werden eine zentrale Rolle bei der Bekanntmachung der neuen Zuständigkeiten und Abläufe spielen, da der Erstkontakt mit Betroffenen vielfach über sie erfolgt.
Nationale kirchliche Informationsstelle ist bereit
Voraussetzung für die Zusammenarbeit mit den kantonal anerkannten Opferberatungsstellen war die Schaffung einer Informationsstelle seitens der Kirche, welche die unabhängigen Beraterinnen und Berater in sämtlichen kirchenspezifischen Fragen unterstützt. Sie nimmt die Anfragen der Opferberatungsstellen entgegen und beantwortet diese mit Unterstützung eines Pools von Fachpersonen, die mit kirchenrechtlichen Fragen sowie mit den Strukturen und Institutionen der katholischen Kirche in der Schweiz vertraut sind. Angelica Venzin ist als Ansprechperson der deutschen Schweiz tätig, für die lateinische Schweiz ist es Béatrice Vaucher. Der Aufbau des Pools an Fachpersonen ist in Gang.
Das Zusammenwirken der Opferberatungsstellen mit der kirchlichen Informationsstelle wird nach einer zweijährigen Pilotphase evaluiert.
Grundlagen für die Professionalisierung des Personalmanagements sind erarbeitet
In den letzten Monaten wurde mit dem für HR-Fragen spezialisierten Unternehmen von Rundstedt ein Leitfaden erarbeitet, der Standards zur Führung und Archivierung von Personaldossiers sowie der Weitergabe von Personalinformationen formuliert. Um die Praxistauglichkeit auf allen Ebenen sicherzustellen, werden nun Rückmeldungen bei Personalverantwortlichen eingeholt. Schulungsangebote zur Umsetzung des Leitfadens starten voraussichtlich Mitte 2025.
In Zusammenarbeit mit Prof. Jérôme Endrass, Leiter Forschung & Entwicklung beim Amt für Justizvollzug und Wiedereingliederung des Kantons Zürich, und seinem Team wurde ein psychologisches Assessment (Abklärungsverfahren) ausgearbeitet. Dieses dient als Basis für ein sorgfältiges und schweizweit einheitliches Auswahlverfahren. Priesteramtskandidaten sowie angehende Seelsorger und Seelsorgerinnen werden dieses Assessment künftig standardmässig durchlaufen.
Die katholische Kirche hat dafür verbindliche Standards festgelegt. Grundlage bilden Basiskompetenzen, die für den Erwerb seelsorgerischer Fertigkeiten und eine erfolgreiche Berufsausübung erforderlich sind. Ziel des Assessments ist die Überprüfung dieser Kompetenzen sowie die Identifikation möglicher Risiken für Dritte. Die Bischofskonferenz hat der flächendeckenden Einführung und Umsetzung der Assessments ab Mitte 2025 zugestimmt. Dazu sind nun Fragen zu Organisation und Kommunikation zu klären.
Weitere Massnahmen sind in Arbeit (mehr dazu im beiliegenden Faktenblatt):
- Im Herbst 2024 haben die zuständigen vatikanischen Stellen in Rom der Schaffung des nationalen kirchlichen Straf- und Disziplinargerichts zugestimmt. Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Bischof Joseph Maria Bonnemain erarbeitet nun die rechtlichen Grundlagen. In dieser Arbeitsgruppe wirken neben kircheninternen Kirchenrechtsexperten auch Prof. Dr. Brigitte Tag (Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht und Medizinrecht an der Universität Zürich) und Pierre Cornu (Richter am Obergericht des Kantons Neuenburg) mit. Bereits in Gang ist auch die Suche nach dem künftigen Gerichtspersonal.
Ziel des Gerichts ist, die Gefahr der Befangenheit zu reduzieren und die korrekte und schweizweit einheitliche Anwendung der kircheneigenen Richtlinien und Strafnormen im Umgang mit Missbrauchsfällen zu gewährleisten. Analog zum staatlichen Strafverfahren sollen im kirchlichen Strafverfahren die Schutz-, Informations- und Verfahrensrechte der Betroffenen definiert und garantiert werden. Dabei haben die zivilen schweizerischen Strafgesetze und das Einschalten der Strafverfolgungsbehörden weiterhin in jedem Fall Vorrang.
- Seit Januar 2024 läuft die dreijährige historische Fortsetzungsstudie, welche die Kirche bei der Universität Zürich in Auftrag gegeben hat und mit 1,5 Mio. Franken finanziert. Die Resultate werden 2027 präsentiert.
- Bereits 2023 haben sich die Bistümer und Landeskirchen sowie zahlreiche Ordensgemeinschaften verpflichtet, künftig keine Akten mehr zu vernichten, die im Zusammenhang mit Missbrauchsfällen stehen.
Nationale Dienststelle neu mit Dreierteam für alle drei Sprachregionen
Im Juli 2024 hat die nationale Dienststelle Missbrauch im kirchlichen Kontext unter der Leitung von Stefan Loppacher ihre Arbeit aufgenommen. Seit Anfang Januar 2025 verstärken Annegret Schär und Mari Carmen Avila das Team. Mit 140 Stellenprozenten wird die Dienststelle im Auftrag der drei kirchlichen Institutionen die gemeinsam beschlossenen Massnahmen zur Verhinderung von Missbrauch und dessen Vertuschung bearbeiten und koordinieren.
Statements der drei kirchlichen Auftraggeberinnen
«Die Betroffenen von Missbrauch im kirchlichen Umfeld sowie die gesamte Gesellschaft sollen sich vergewissern können, dass die katholische Kirche in der Schweiz Machtmissbrauch bekämpft und griffige Präventionsmassnahmen umgesetzt hat. Den Worten und Versprechungen sind Taten gefolgt. Der Prozess der wirkungsvollen Verhinderung von Missbrauch jeglicher Art wird dennoch niemals beendet sein. Die Kirche, wie die gesamte Gesellschaft, muss sich dem Thema auf allen Ebenen und in jeder Form ihrer Auswüchse fortlaufend annehmen, um gemeinsam die nötigen präventiven Massnahmen auszuarbeiten und umzusetzen.»
Joseph Maria Bonnemain, Bischof von Chur und Themenverantwortlicher der SBK
«Gewisse erste Meilensteine wurden 2024 erreicht; die Intensität der Weiterarbeit an der Umsetzung dieser Massnahmen wird nicht abnehmen und uns noch lange beschäftigen. Wir wollen das gesamtschweizerische Umfeld mit unseren verschiedenen Sprachen, Kulturen, Erfahrungen und rechtlichen Strukturen nutzen, um, mit Einbezug der Betroffenenorganisationen, breitabgestützte Lösungen für unsere Kirche zu finden.»
Roland Loos, Präsident der RKZ
«Die Ordensgemeinschaften – insbesondere die Männerorden, in deren Reihen sich erwiesenermassen bereits verstorbene oder noch lebende Täter finden – tragen nach wie vor eine besondere Verantwortung gegenüber den Opfern von sexuellem und anderen Formen von Missbrauch. Obwohl sich viele Ordensgemeinschaften in einer personell prekären Lage befinden, sind sie sich der Pflicht bewusst, die beschlossenen Massnahmen mitzutragen und sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten und in ihren Zuständigkeitsbereichen umzusetzen. Trotz ihres fragilen Zustandes wollen sie auf ihre ordensspezifische Weise den für die gesamte Kirche überfälligen Kulturwandel aktiv mitgestalten und voranbringen.»
Pater Peter von Sury, Mariastein, Themenverantwortlicher der KOVOS
Weitere Informationen
Projektwebseite der Auftraggeberinnen: www.missbrauch-kath-info.ch
Pilotprojekt zur Geschichte des sexuellen Missbrauchs im Umfeld der römisch-katholischen Kirche in der Schweiz seit Mitte des 20. Jahrhunderts, Universität Zürich: Schlussbericht des Forschungsteams
Auskünfte
SBK: Bischof Joseph Maria Bonnemain (Themenverantwortlicher)
RKZ: Roland Loos (Präsident)
KOVOS: Pater Peter von Sury (Themenverantwortlicher)
Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder 079 323 19 21
Dolores Waser Balmer und Elena Anita Furrer übernehmen Prävention im Bistum Chur
Information vom 26. Juni 2024
Mit Dolores Waser Balmer und Elena Anita Furrer führen zwei ausgewiesene Fachfrauen die Präventionsarbeit im Bistum Chur ab Anfang Oktober 2024 weiter. Bischof Bonnemain ist froh, mit Waser Balmer und Furrer eine Doppelleitung zu präsentieren, die sich in idealer Weise ergänzt. Beide Frauen teilen sich die Stelle zu je 50 Prozent. Wie bis anhin wird die Prävention im Bistum Chur finanziell von den sieben staatskirchenrechtlichen, kantonalen Körperschaften getragen. Die Anstellung erfolgt über die kantonale Körperschaft Zürich. Fachlich und strategisch sind sie direkt dem Diözesanbischof unterstellt.
Dolores Waser Balmer (Jg. 1967) leitet aktuell die Fachstelle Diakonieanimation des Bistums St. Gallen. Nach ihrer Ausbildung zur Pflegefachfrau HF absolvierte sie Aus- und Weiterbildungen wie MAS Management Soziale Dienstleistungen, CAS Kinder- und Jugendpsychiatrie, CAS Sozialmanagement, CAS Führen und Leiten von Teams, Systematische Interaktionstherapie SIT. Sie leitete das Kinderschutzzentrum St. Gallen und ist Dozentin an der BZSG St. Gallen zu den Themen Kindesmisshandlung, Erziehung im Kontext verschiedener Kulturen und Kommunikation mit Jugendlichen. 2016 wurde sie mit dem Mandat zur Einführung eines Schutzkonzeptes im Bistum St. Gallen betraut und ist dort Mitglied der Kommission Schutz und Prävention. Im Auftrag des Bischofs von St. Gallen war sie von 2016 bis 2021 Ansprechperson der Fachgremium gegen sexuelle Ausbeutung im Bistums St. Gallen.
Elena Anita Furrer (Jg. 1994) hat an den Universitäten Fribourg/Freiburg und Zürich Theologie studiert sowie sich in den Bereichen Rechts- und Islamwissenschaften vertieft. Seit März 2024 besucht sie einen DAS systemische Beratung an der ZHAW. Während zwei Jahren war sie im Bistum St. Gallen Leiterin des Fachbereiches Junge Erwachsene & Berufung. Seit November 2023 ist sie in der Schweizer Armee für die Rekrutierung und Ausbildung der zukünftigen Seelsorgenden der Schweizer Armee und deren Weiterbildung zuständig. Sie verfügt über fundierte Erfahrungen in der Projektleitung und Erwachsenenbildung.
Die neuen Präventionsbeauftragten verfügen über die geforderten Kenntnisse des dualen Systems der katholischen Kirche in der Schweiz. Beide Frauen ergänzen sich ideal. Eine bringt eine lange Erfahrung im Bereich der Prävention von Macht- und sexuellem Missbrauch im Kontext der katholischen Kirche mit; die andere ist eine Theologin, die gewohnt ist, im Bereich der Ausbildung und Leitung einer grossen Organisation wie die Schweizer Armee zu wirken.
Seit längerer Zeit ist Bischof Bonnemain der Überzeugung, dass eine engere Zusammenarbeit der drei Deutschschweizer Bistümer im Bereich der Prävention stattfinden soll. Mit den jetzigen Ernennungen wird ein wesentlicher Schritt in diese Richtung getan. Er ist froh, mit der Ernennung der beiden Fachfrauen auf Anfang Oktober einen fast nahtlosen Übergang der Prävention gegen sexuelle Gewalt und Machtmissbrauch im Bistum Chur gewährleisten zu können.